Wenn ein Gesellschafter ohne vertragliche Regelung aus einer GmbH ausscheidet und seine Anteile veräußern möchte, stehen Bewertung, Preisverhandlung und mögliche Ausgleichsansprüche im Zentrum des Konflikts. Maßgeblich ist in solchen Fällen der Verkehrswert, regelmäßig ermittelt durch das Ertragswertverfahren, unter Anwendung des Fremdvergleichsprinzips. Persönliche Aufbauleistungen – etwa bei der Gründung, Markenentwicklung oder Kundengewinnung – können den Unternehmenswert objektiv steigern, müssen aber nachweisbar, wirtschaftlich zurechenbar und vertraglich verankert sein, um anteilswerterhöhend oder vergütungswirksam berücksichtigt zu werden.
Fehlt eine entsprechende Regelung, drohen steuerliche Risiken: Sondervergütungen ohne Fremdvergleich können als verdeckte Gewinnausschüttung qualifiziert werden, Verkäufe unter Wert als verdeckte Einlage. Bei gravierenden Leistungslücken kann ausnahmsweise ein Rückgriff auf bereicherungsrechtliche Grundsätze (§ 812 BGB) oder analog auf gemeinschaftsähnliche Verhältnisse erfolgen – etwa wenn Leistungen ohne Gegenleistung in die Gesellschaft eingebracht wurden.
Zur Streitlösung bieten sich Mediation, neutrale Bewertungsgutachten oder gerichtliche Verfahren an. Wo keine klare Bewertung vereinbart ist, entscheidet letztlich der objektiv belegbare Marktwert. Entscheidend bleibt: Nur wer seine Leistungen, Rechte und Bewertungen klar strukturiert und rechtlich einordnet, kann im Austrittsfall durchsetzen, was er wirtschaftlich verdient.

Unternehmensbewertung und Anteilsverkäufe: Gesetzliche Vorgaben und Bewertungspraxis bei fehlender gesellschaftsvertraglicher Regelung
Wenn ein Gesellschafter aus einem Unternehmen ausscheiden und seine Anteile veräußern möchte, stellt sich regelmäßig die Frage nach dem richtigen Wert. Was aber gilt, wenn im Gesellschaftsvertrag keinerlei Regelung zur Bewertung enthalten ist? Genau diese Fallkonstellation betrifft viele Start-ups und junge Unternehmen, bei denen Bewertungsfragen oft emotional, wirtschaftlich und rechtlich aufgeladen sind.
Kein gesetzlicher Maßstab – aber anerkannte Standards
Ein einheitlich gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren zur Bewertung von Unternehmensanteilen existiert nicht. Auch das GmbH-Gesetz oder das HGB enthalten hierzu keine allgemeingültigen Vorgaben. Fehlt eine vertragliche Regelung, orientiert sich die Praxis an betriebswirtschaftlich anerkannten Methoden, während die Rechtsprechung regelmäßig den sogenannten Verkehrswert als Maßstab akzeptiert (vgl. George, PFB 2019, 341, 342).
Im Steuerrecht wiederum kommen – je nach Bewertungsanlass – spezifische Verfahren zur Anwendung. Bei Unternehmensanteilen im Privat- oder Betriebsvermögen spielt etwa das vereinfachte Ertragswertverfahren nach §§ 199 ff. BewG eine Rolle (vgl. Ottersbach, Lexikon des Steuerrechts, Stand 158. Lieferung 2025). Für einkommensteuerliche Zwecke regelt § 6 EStG in Verbindung mit § 3c Abs. 2 EStG und § 8b KStG zudem, inwieweit Teilwertansätze bzw. nachträgliche Anschaffungskosten steuerlich zu berücksichtigen sind (vgl. Korn/Strahl in: Korn, EStG, 160. Erg.-Lfg., § 6 Rn. 307.2, 308).
Bewertungsverfahren in der unternehmerischen Praxis
Ertragswertverfahren
Das klassische Verfahren kapitalisiert künftige Gewinne auf einen heutigen Barwert. Es ist bewährt, aber bei jungen Unternehmen mit unsicherer Ertragslage schwer anzuwenden (vgl. Hammes/Schlender, SJ 2005, 32).
Discounted-Cashflow-Methode (DCF)
Das DCF-Verfahren bewertet auf Grundlage erwarteter Cashflows. Die Genauigkeit leidet jedoch bei Start-ups erheblich unter unsicheren Prognosen und asymmetrischer Informationsverteilung (vgl. Noever/Schaumann/Schölzel/Warm, DB 2020, 2081, 2084).
Multiplikatorverfahren
Besonders in der Frühphase werden Unternehmenswerte anhand von Branchen-Multiplikatoren geschätzt. Diese Methode wird aber dann problematisch, wenn keine geeigneten Vergleichsunternehmen existieren (vgl. ebd., 2085).
Substanzwertverfahren
Dieses Verfahren ist bei start-up-typischen Geschäftsmodellen mit immateriellen Werten unbrauchbar – es berücksichtigt vorrangig materielle Vermögenswerte.
Qualitatives Scoring-Verfahren
Ein innovativer Ansatz ist das Scoring-Sheet-Modell, das qualitative Kriterien wie Gründerpersönlichkeit, Netzwerkstärke oder Innovationsgrad bewertet. Dieses Verfahren kann gerade im Rahmen von Gesellschafterkonflikten helfen, immaterielle Beiträge angemessen abzubilden (vgl. Noever/Schaumann/Schölzel/Warm, DB 2020, 2085).
Streitfälle und juristische Leitlinien
Bewertungsstreitigkeiten entzünden sich häufig an der Frage, ob Minderheitsabschläge, Fungibilitätsabschläge oder ein bestimmter Kapitalisierungszinssatz angemessen sind. Die Rechtsprechung erkennt an, dass Bewertungsfragen Rechtsfragen sind – etwa wenn sie über den Zugang zu Abfindung oder Veräußerungserlös entscheiden. Minderheitsabschläge werden dabei zunehmend abgelehnt (vgl. Fleischer, ZIP 2012, 1633, 1637).
Earn-Out-Klauseln – dynamische Preismechanik
In der M&A-Praxis werden sogenannte Earn-Out-Klauseln genutzt, um Bewertungsdifferenzen zu überbrücken. Sie machen Teile des Kaufpreises abhängig von künftigen Entwicklungen (z. B. EBITDA oder Umsatz). Steuerlich entstehen dadurch regelmäßig nachträgliche Anschaffungskosten, sobald die Bedingungen eintreten (vgl. Korn/Strahl in: Korn, EStG, § 6 Rn. 308).
Empfehlung: Kombination aus Bewertung und rechtlicher Absicherung
In der Praxis empfiehlt es sich, Bewertungsverfahren – einschließlich Bewertungszeitpunkt, Methodenwahl und ggf. externer Gutachter – im Gesellschaftsvertrag klar zu regeln (vgl. Winter in Ott, Handbuch Mittelständische Unternehmen, 170. Update 2025, III. Abschluss des Gesellschaftsvertrags). Fehlt eine solche Regelung, kann eine einvernehmliche Bewertung durch einen neutralen Gutachter oder ein kombinierter Bewertungsansatz (z. B. DCF + Scoring-Modell) eine sachgerechte Lösung bieten.
Gerade bei Gründergesellschaftern mit überdurchschnittlichen Leistungen ist darauf zu achten, dass immaterielle Beiträge (z. B. Geschäftsidee, Netzwerke, Markenaufbau) nicht systematisch unterbewertet werden. Die Bewertung muss den realen wirtschaftlichen Verhältnissen gerecht werden – und das bedeutet in solchen Fällen oft: mehr als der Buchwert.

Besondere Leistungen von Gesellschaftern: Anspruch auf zusätzliche Vergütung?
In vielen Start-ups leisten einzelne Gesellschafter deutlich mehr als nur die Kapitalbeteiligung. Sie entwickeln das Geschäftsmodell, gewinnen Kunden, bauen die Marke auf – und stehen später vor der Frage: Reicht mein Anteil am Unternehmen als „Entlohnung“ aus, oder habe ich Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung?
Ausgangspunkt: Keine gesetzliche Regelung für Sondervergütung
Das Gesetz kennt keinen pauschalen Anspruch eines Gesellschafters auf zusätzliche Vergütung für seine Mitwirkung, sofern keine ausdrückliche Vereinbarung besteht. Im Gegenteil: Die Rechtsprechung betont, dass die Tätigkeit eines Gesellschafters grundsätzlich durch seine Gewinnbeteiligung abgegolten ist (Brandenburgisches OLG, Urt. v. 30.03.2007 – 7 U 164/06, juris Rn. 20).
Ein Vergütungsanspruch kann sich daher nur aus einer ausdrücklichen Regelung im Gesellschaftsvertrag oder einem nachträglichen Gesellschafterbeschluss ergeben. Fehlen solche Regelungen, sind Ansprüche nur in engen Ausnahmefällen durchsetzbar.
Vorabgewinne und Sondervergütung
Der einfachste Weg zur Kompensation besonderer Leistungen besteht in der Vereinbarung eines Vorabgewinns. Dieser ist gesellschaftsrechtlich zulässig und wird vor der regulären Gewinnverteilung ausgeschüttet. Er setzt jedoch eine vertragliche oder durch Beschluss dokumentierte Grundlage voraus (Wichmann, Stbg 2020, 298 ff.).
Fehlt diese Grundlage, kann eine gesonderte Tätigkeitsvergütung ausnahmsweise als schuldrechtliche Leistung betrachtet werden – etwa dann, wenn die Gesellschaft dem Gesellschafter eine konkrete, abgrenzbare Aufgabe überträgt, die über die typischen Gesellschafterpflichten hinausgeht (BGH, Urt. v. 25.04.1966 – II ZR 120/64).
Rechtsprechung: Keine konkludente Vergütung ohne klare Grundlage
Die Gerichte sind bei der Anerkennung solcher Ansprüche äußerst zurückhaltend. Selbst erhebliche Mitwirkung bei der Gründung oder operativen Führung des Unternehmens begründet keinen automatischen Zahlungsanspruch. Die gesellschaftsrechtliche Sonderstellung hat Vorrang: Vergütung bedarf eines expliziten Rechtsgrunds (FG Hannover, Urt. v. 16.10.2012 – 3 K 251/12).
Ein etwaiger Anspruch aus Geschäftsbesorgung (§ 670 BGB analog) oder für Dienstleistung (§ 612 BGB analog) ist nach ständiger Rechtsprechung ausgeschlossen, wenn die Tätigkeit im typischen Rahmen einer Gesellschaftermitwirkung erfolgt (Brandenburgisches OLG, a.a.O.).
Steuerliche Besonderheiten: Vorsicht vor verdeckter Gewinnausschüttung
Kommt es doch zu einer Sondervergütung ohne vertragliche Grundlage, droht steuerlich die Einordnung als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA). Diese führt dazu, dass die Vergütung nicht als Betriebsausgabe abziehbar ist – und beim Gesellschafter unter Umständen zu einer Nachversteuerung führt (Harle/Kulemann, Lexikon des Steuerrechts, Stand 158. Lfg. 2025).
Die Rechtsprechung verlangt daher, dass die Vergütung fremdüblich, angemessen und formal korrekt beschlossen ist – andernfalls drohen erhebliche steuerliche Risiken (Feldgen, eNews 2020, 24.08.2020).
Gründung und Sonderleistung: Einzelfallprüfung entscheidend
Wurde ein Unternehmen maßgeblich durch die Kreativität, Netzwerke oder Arbeitskraft eines Gesellschafters aufgebaut, ohne dass dies im Gesellschaftsvertrag abgebildet ist, stellt sich die Frage: Ist eine nachträgliche Vergütung möglich?
Zwar erkennt die Literatur an, dass außergewöhnliche Leistungen zu einer modifizierten Bewertung des Anteils führen können – etwa im Fall der Abfindung oder bei Verhandlungen über den Verkauf. Doch rechtlich durchsetzbar ist ein Vergütungsanspruch nur bei klar nachgewiesener Abrede oder Beschlusslage (vgl. Schlitt, in: BDI/Warth & Klein Grant Thornton, 2. Aufl. 2021, Teil III, Rn. 7).

Bereicherungsrecht und eheähnliche Grundsätze im Gesellschafterverhältnis: Rechtsdogmatische Öffnungen
Wenn Gesellschafter erhebliche Leistungen für die gemeinsame Gesellschaft erbringen, ohne dafür eine explizite Vergütung oder Gegenleistung zu erhalten, stellt sich zwangsläufig die Frage: Besteht ein Anspruch auf Ausgleich – auch ohne vertragliche Regelung? Die dogmatische Öffnung hin zur Anwendung bereicherungsrechtlicher Grundsätze oder analoger Gedanken aus dem Familienrecht (insb. Ehegattengemeinschaft) bietet in der Praxis eine bemerkenswerte Flanke für eine wirtschaftlich faire Kompensation.
Bereicherungsrechtliche Rückgriffsebene nach § 812 BGB
Ein Anspruch auf Rückgewähr kann sich gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB ergeben, wenn ein Gesellschafter ohne Rechtsgrund Leistungen erbringt, die einem anderen Gesellschafter oder der Gesellschaft selbst zugutekommen. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen:
-
keine Regelung zur Entlohnung im Gesellschaftsvertrag besteht
-
keine Einlagepflicht besteht oder überobligatorische Leistungen erbracht wurden
-
die Leistung auf einem Zweck beruhte, der nicht verwirklicht wurde
Die Rechtsprechung erkennt solche Rückforderungsansprüche grundsätzlich an, sofern keine gesellschaftsrechtlichen Spezialregelungen entgegenstehen (vgl. BFH, Urt. v. 22.04.1998 – X R 101/95, juris Rn. 28; BGH, Urt. v. 03.02.2010 – XII ZR 189/06, NJW 2010, 1451).
Zweckverfehlungskondiktion und faktische Gemeinschaft
Eine besonders interessante Variante ist die sog. Zweckverfehlungskondiktion (§ 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB), die dann greift, wenn eine Leistung „für einen bestimmten Zweck“ erfolgt ist, dieser jedoch nicht erreicht wurde. Diese Denkfigur wurde ursprünglich im Kontext nicht ehelicher Lebensgemeinschaften entwickelt – etwa bei gemeinsamem Immobilienerwerb – und von der Rechtsprechung auf Gesellschaften mit tatsächlich gelebter Zusammenarbeit ohne Vertragssicherheit übertragen (vgl. Grziwotz, MittBayNot 1994, 338 f.).
Gerade bei Gründungsprojekten, bei denen der eine Gesellschafter maßgeblich investiert und der andere nach wenigen Monaten dominiert oder die Verwertung kontrolliert, kann dies eine Dogmatik zur Rückabwicklung oder Wertzurechnung eröffnen – außerhalb klassischer gesellschaftsrechtlicher Auseinandersetzungsmodelle.
Subsidiarität des Bereicherungsrechts
Die Anwendung des Bereicherungsrechts ist jedoch nicht primär, sondern subsidiär. Sie kommt nur zum Tragen, wenn weder gesellschaftsrechtliche noch familienrechtliche Vorschriften Vorrang beanspruchen (vgl. FG Düsseldorf, Beschl. v. 28.11.2000 – 10 V 6594/00 A (E), EFG 2001, 63).
Bei Gesellschaftern ohne gesellschaftsvertragliche Regelung und ohne festgelegten Auseinandersetzungsmechanismus könnte diese Subsidiarität zugunsten des Bereicherungsrechts zurücktreten, da sonst eine ungerechtfertigte Vermögensverlagerung ohne Rechtsgrund erfolgen würde.
Analogie zu Gütergemeinschaften und Ehegattenmodellen
Besonders spannend ist die Analogie zur Gütergemeinschaft bei Ehegatten. So hat der BFH bereits früh anerkannt, dass Leistungen im Rahmen gemeinschaftlich geführter Betriebe wie gesellschaftsrechtlich gebundene Vermögenswerte zu behandeln sind (BFH, Urt. v. 01.03.1966 – I 226/64, BStBl III 1966, 344). Daraus folgt:
-
Der arbeitende Ehegatte kann nicht isoliert für seine Tätigkeit entlohnt werden, wenn diese im Rahmen einer gesamthänderischen Vermögensbindung erfolgte.
-
Gleiches könnte für Gesellschafter gelten, die in einer faktischen „Partnerschaftsgesellschaft“ tätig waren, ohne explizite Entlohnungsvereinbarung.
Dies öffnet dogmatisch die Möglichkeit, auch bei nicht verheirateten Gesellschaftern eine analoge Anwendung gesellschaftsrechtlicher Auseinandersetzungsregeln zu prüfen – insbesondere bei Auflösung oder Exit.
Vermögensausgleich bei Auflösung oder Exit
In Fällen, in denen der eine Gesellschafter den Betrieb verlässt oder verdrängt wird, während der andere den Gesamtwert nutzt, lässt sich eine Analogie zu §§ 730 ff. BGB (Auflösung der GbR) oder zur Zugewinnausgleichssystematikbegründen (vgl. Hof, in: Steuerberater-Rechtshandbuch, 192. Lfg. 2025, Kap. III).
Solche Konstellationen treten besonders häufig auf, wenn:
-
kein Gesellschaftsvertrag geschlossen wurde
-
beide Gesellschafter in Aufbau, Finanzierung und operativer Tätigkeit gleichwertig involviert waren
-
einseitig der Zugriff auf Unternehmenswerte (Konten, Domain, Marke) erfolgt ist
Bereicherungsrecht als wertvolle Reserve in streitigen Gesellschafterkonflikten
Bereicherungsrechtliche und familienrechtlich inspirierte Grundsätze bieten eine strategische Ergänzung zum klassischen Gesellschaftsrecht. Besonders in faktischen, nicht ausreichend dokumentierten Start-up-Gründungen können sie einen juristisch fundierten Rückforderungsanspruch begründen – oder zumindest zu einer faireren Anteilsbewertung beitragen. Ihre Anwendung hängt stets von der Substanz der Zusammenarbeit und dem Fehlen anderweitiger Regelungen ab – aber genau das ist oft die Realität bei jungen, dynamischen Gründungen.
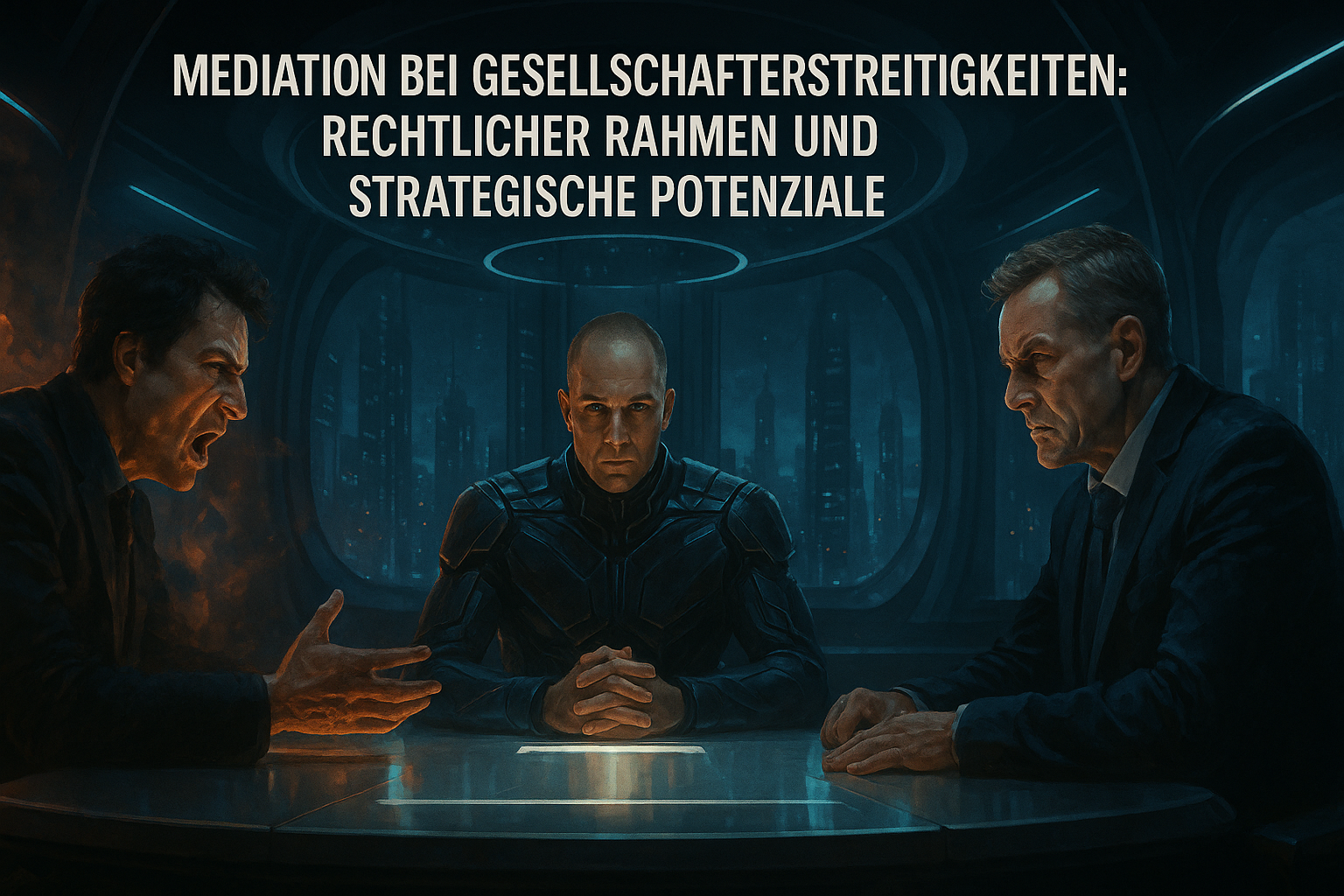
Gesellschafterstreitigkeiten über Anteilsverkäufe: Rechtsdurchsetzung und Preisfestsetzung
Wenn sich Gesellschafter nicht über den Verkauf von Anteilen einigen können, stehen schnell zentrale Fragen im Raum: Ist der verlangte Preis gerechtfertigt? Darf ein Mehrheitsgesellschafter den Preis drücken? Und wie lassen sich berechtigte Interessen eines Minderheitsgesellschafters schützen?
Gerade bei Start-ups mit unklarer Bewertung oder einseitiger Kontrolle durch eine dominierende Gesellschaftergruppe sind Streitigkeiten vorprogrammiert. Die rechtlichen Instrumente zur Auflösung solcher Konflikte sind vielfältig – und in der Praxis oft entscheidend für die wirtschaftliche Existenz des ausscheidenden Gesellschafters.
Juristische Mechanismen bei Uneinigkeit über den Verkaufspreis
Zunächst ist der Blick in den Gesellschaftsvertrag entscheidend. Dieser kann Vorkaufsrechte, Bewertungsverfahren (z. B. durch unabhängige Gutachter) oder Abfindungsregeln enthalten. Solche Regelungen sind bindend und setzen den Rahmen für jede Streitentscheidung (vgl. Krüger, HFR 2017, 36, 38).
Fehlt eine vertragliche Regelung – wie im vorliegenden Fall – greift das allgemeine Gesellschaftsrecht. Die Beteiligten können sich dann auf:
-
das Prinzip des Fremdvergleichs
-
die Anwendung marktüblicher Bewertungsmethoden
-
sowie auf gerichtliche Kontrolle nach § 242 BGB berufen.
Wird keine Einigung erzielt, kann der Streit durch ein gerichtliches Gutachten oder im Rahmen eines selbständigen Beweisverfahrens geklärt werden.
Strategien gegen unrechtmäßige Preisdrückung
Versucht ein Gesellschafter, die Bewertung systematisch zu seinen Gunsten zu manipulieren (etwa durch Ausklammerung immaterieller Vermögenswerte oder fiktive Schulden), kann dies als treuwidriges Verhalten im Sinne von § 242 BGB gewertet werden. Dies gilt insbesondere, wenn ein beherrschender Gesellschafter seine Dominanz ausnutzt, um den Minderheitsgesellschafter wirtschaftlich zu verdrängen (vgl. OLG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 30.05.2002 – 2 U 42/01, juris Rn. 21).
In solchen Fällen sind insbesondere folgende Gegenmaßnahmen möglich:
-
Klage auf Einhaltung gesellschaftsrechtlicher Pflichten (Verletzung der Treuepflicht, unzulässige Vermögensverschiebung)
-
Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen, die auf einer manipulativen Preisfestsetzung beruhen
-
Schadensersatzansprüche gegen die übervorteilende Partei
Bewertung durch neutrale Instanz
Zur objektiven Lösung solcher Streitigkeiten empfiehlt sich die Einsetzung eines neutralen Sachverständigen, der den Wert der Anteile unter Anwendung anerkannter Bewertungsverfahren ermittelt – typischerweise Ertragswertverfahren, DCF oder Marktvergleich (vgl. BFH, Urt. v. 15.09.2004 – I R 7/02, BStBl II 2005, 523).
Eine der häufigsten Ursachen für gerichtliche Auseinandersetzungen ist die einseitige Berufung auf einen „subjektiven“ Unternehmenswert durch den Käufer. Die Rechtsprechung verlangt hier regelmäßig die Orientierung an einem objektiven Marktwert – auch im Innenverhältnis der Gesellschafter.
Einstweiliger Rechtsschutz und Verfahrensstrategien
Ein besonders effektives Mittel zur Verhinderung irreversibler Maßnahmen (z. B. Verkauf unter Wert) ist der Antrag auf eine einstweilige Verfügung, etwa mit dem Ziel, die Übertragung bis zur gerichtlichen Klärung zu stoppen. Daneben können auch Schiedsverfahren nach gesellschaftsvertraglicher Klausel oder ein selbständiges Beweisverfahren zur sachlichen Entschärfung beitragen.
Gerichte haben mehrfach betont, dass der Schutz des Minderheitsgesellschafters bei wirtschaftlichen Zwangssituationen Vorrang haben kann – insbesondere wenn keine ausgewogene Vertragslage besteht oder die gesellschaftsrechtliche Ordnung ausgehöhlt wird (vgl. FG Hannover, Urt. v. 18.01.2000 – 6 K 508/97, EFG 2000, 818 f.).
Marktüblicher Preis und Fremdvergleich
Ein zentrales Prinzip bei der Bewertung von Anteilen ist das Fremdvergleichsprinzip. Danach muss jede Preisfindung dem Stand entsprechen, der zwischen unabhängigen Dritten vereinbart worden wäre. Dies gilt nicht nur für steuerliche Zwecke (z. B. § 8 Abs. 3 KStG), sondern auch zivilrechtlich im Rahmen der Treuepflichten (vgl. BFH, Urt. v. 01.09.2016 – VI R 67/14, HFR 2017, 36).
Weicht der angesetzte Preis signifikant vom Marktwert ab, kann dies eine verdeckte Gewinnausschüttung, eine sittenwidrige Benachteiligung oder eine pflichtwidrige Preisfestsetzung darstellen – mit erheblichen steuerlichen und zivilrechtlichen Folgen.
Ein Minderheitsgesellschafter hat in einem Anteilsverkaufsstreit keinen automatischen Anspruch auf einen „Wunschpreis“ – aber er kann sich erfolgreich gegen unberechtigte Abwertungen wehren. Die Rechtsprechung erkennt an, dass der Marktwert der maßgebliche Ankerpunkt ist. Das Fremdvergleichsprinzip, der Rückgriff auf neutrale Bewertung, die Geltendmachung von Treuepflichtverletzungen sowie der einstweilige Rechtsschutz bilden dabei das zentrale Instrumentarium zur Verteidigung wirtschaftlicher Interessen in Gesellschafterkonflikten.
Mediation bei Gesellschafterstreitigkeiten: Rechtlicher Rahmen und strategische Potenziale
Nicht jeder Gesellschafterstreit muss vor Gericht enden. Gerade bei Auseinandersetzungen über Bewertungen, Austritte oder Unternehmensstrategie bietet die Mediation ein rechtlich anerkanntes, interessenorientiertes Verfahren zur Lösung wirtschaftlicher Konflikte. Ihr Erfolg hängt jedoch maßgeblich von der Ausgestaltung des gesellschaftsrechtlichen Rahmens ab – und der Bereitschaft der Parteien, sich auf eine gemeinsame Lösung einzulassen.
Mediation als vertrauliches und flexibles Instrument
Die Mediation ist ein außergerichtliches Verfahren, bei dem ein neutraler Dritter die Parteien bei der Suche nach einer interessengerechten Lösung unterstützt – ohne Entscheidungsbefugnis. Sie beruht auf Freiwilligkeit, Eigenverantwortung und Vertraulichkeit. Der strukturierte Ablauf umfasst typischerweise:
-
Konfliktklärung und Interessenanalyse
-
Entwicklung von Lösungsoptionen
-
Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung
Diese kann nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO vollstreckbar gemacht werden, etwa durch notarielle Beurkundung (vgl. Leuchtenberg, in: Steuerberater Rechtshandbuch, 192. Lfg. 2025, Kap. IV; Düwell, jurisPR-ArbR 28/2012 Anm. 1).
Mediation eignet sich insbesondere bei Kommunikationskonflikten, Bewertungsdifferenzen und Blockadesituationen, in denen die Gesellschafterbeziehung fortbestehen soll – oder in denen eine einvernehmliche Exit-Lösung gesucht wird (vgl. Dendorfer/Krebs, MittBayNot 2008, 85; Molkenbur, in: Bewegungen/2016, 145).
Gesellschaftsvertragliche Mediationsklauseln
Viele moderne Gesellschaftsverträge enthalten sogenannte Mediations- oder Schlichtungsklauseln, wonach ein Verfahren zur Streitbeilegung zwingend vorgeschaltet werden muss, bevor eine Klage zulässig ist. Diese Klauseln sind wirksam und können als echte prozessuale Sperre wirken (vgl. OLG Frankfurt, Urt. v. 06.05.2014 – 5 U 116/13, GmbHR 2014, 960).
Eine wirksame Klausel sollte regeln:
-
wann und wie das Mediationsverfahren eingeleitet wird
-
wie der Mediator bestimmt wird (z. B. IHK, DIS, EUCON, CEDR)
-
welche Fristen gelten
-
wie die Kosten verteilt werden
Fehlt eine solche Regelung im Vertrag, bleibt die Mediation dennoch jederzeit möglich – allerdings ohne rechtliche Bindung an ein Verfahren oder Fristen.
Mediation und gesellschaftsrechtliche Besonderheiten
Im Gesellschaftsrecht ist die Mediation besonders dann erfolgversprechend, wenn es um:
-
Anteilsbewertungen
-
Austrittsbedingungen
-
Nachfolgefragen
-
Mitbestimmung oder Vetorechte
geht. Der Vorteil: Die Mediation erlaubt maßgeschneiderte Lösungen, die im gerichtlichen Verfahren wegen der Bindung an objektive Rechtslagen nicht erreichbar wären (vgl. Schröder, GmbHR 2014, 963).
Gerade bei Start-ups oder inhabergeführten Gesellschaften kann sie die Brücke zwischen persönlicher Ebene und wirtschaftlicher Realität schlagen – etwa durch Kombination mit einer externen Unternehmensbewertung, gestaffelten Kaufpreisregelungen oder stillen Beteiligungsmodellen.
Grenzen und Risiken der Mediation
Die Mediation ist nicht immer geeignet. Sie stößt dort an ihre Grenzen, wo:
-
eine Partei strukturell dominant ist und kein echtes Verhandlungsinteresse hat
-
strafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen
-
Dritte (z. B. Gläubiger oder Investoren) involviert sind und deren Interessen nicht abgebildet werden können
-
die Vertraulichkeit zum Schutz strategisch missbraucht wird
Problematisch kann zudem die externe Vertraulichkeit sein, etwa wenn keine klaren Regelungen zum Umgang mit Geschäftsgeheimnissen oder Beweismitteln bestehen (vgl. Duve/Prause, IDR 2004, 126; Siebert/Pletke, öAT 2022, 96).
Gesetzlicher Rahmen: MediationsG
Das Mediationsgesetz (MediationsG) vom 21.07.2012 regelt die Rahmenbedingungen. Nach § 1 Abs. 1 MediationsG ist die Mediation ein freiwilliges Verfahren zur einvernehmlichen Beilegung von Streitigkeiten. Der Gesetzgeber stärkt die Verbindlichkeit durch:
-
Regelung der Aufgaben des Mediators (§ 2 MediationsG)
-
Ermöglichung einer Vollstreckbarkeit nach § 794 ZPO
-
Förderung durch staatliche Stellen, z. B. Gerichte und Kammern
Zudem ist anerkannt, dass auch anwaltliche Mediation – also die Mediation durch speziell qualifizierte Rechtsanwälte – unter das Mediationsgesetz fällt.
Mediation ist im Gesellschaftsrecht mehr als nur ein „softes“ Konfliktlösungsmodell. Sie kann bei Gesellschafterstreitigkeiten die entscheidende Wende bringen – vorausgesetzt, sie ist gut vorbereitet, professionell moderiert und in einen klaren vertraglichen oder gesetzlichen Rahmen eingebettet. In der Praxis empfiehlt sich die Kombination aus Mediationsklausel, externer Unternehmensbewertung und ggf. notarieller Abschlussvereinbarung, um Streitigkeiten über Anteilsverkäufe, Bewertungen oder Austritt effektiv und wirtschaftlich zu lösen.
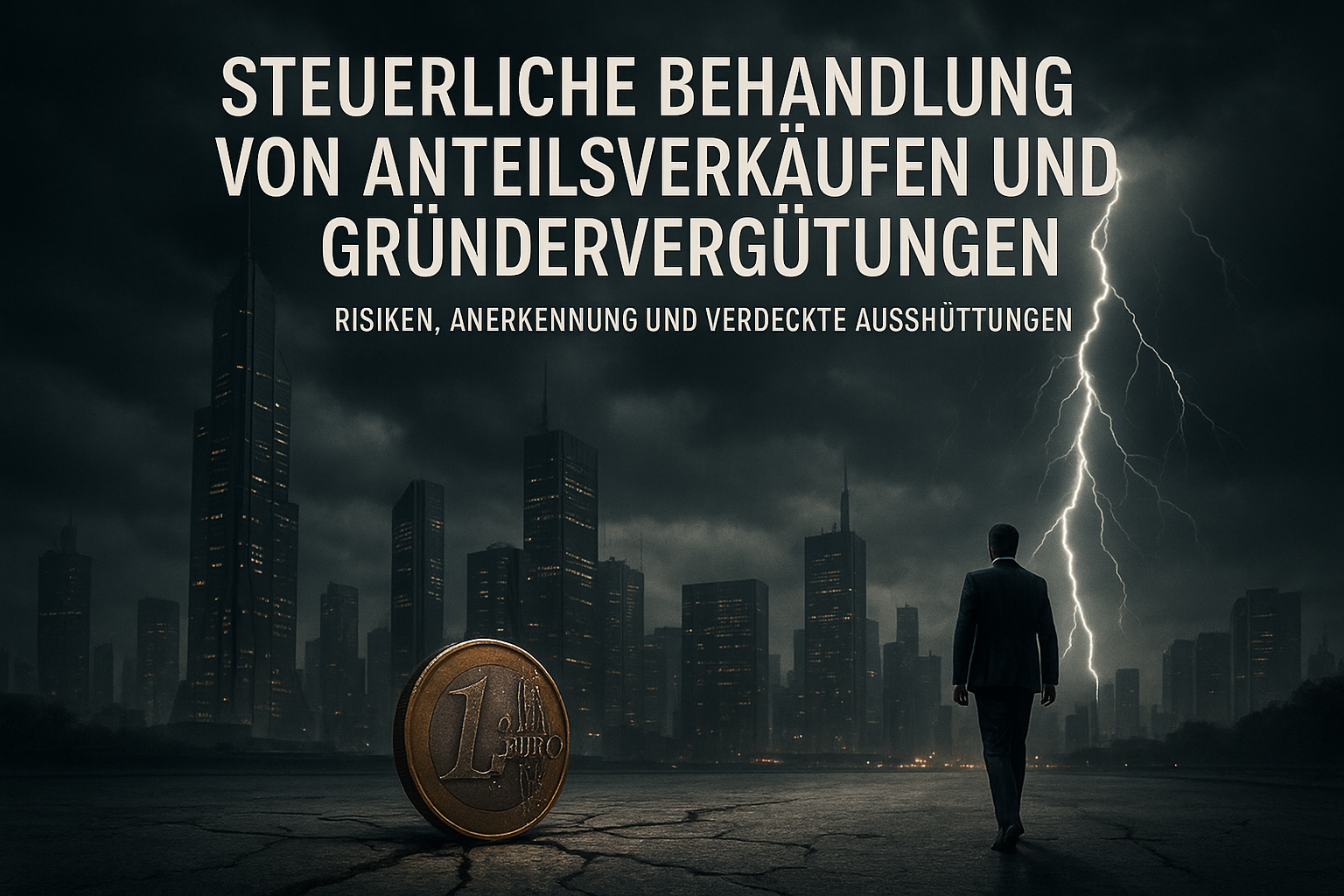
Steuerliche Behandlung von Anteilsverkäufen und Gründervergütungen: Risiken, Anerkennung und verdeckte Ausschüttungen
Der Verkauf von GmbH-Anteilen durch natürliche Personen sowie etwaige Sondervergütungen für frühere Gründerleistungen werfen nicht nur zivilrechtliche, sondern auch komplexe steuerliche Fragen auf. Die Einordnung als Veräußerungsgewinn, verdeckte Gewinnausschüttung oder nachträgliche Anschaffungskosten kann erheblichen Einfluss auf die Steuerlast beider Seiten haben – insbesondere bei konfliktbeladenen Exits aus jungen Unternehmen.
Verkauf von GmbH-Anteilen durch natürliche Personen
Wird ein GmbH-Anteil durch eine natürliche Person veräußert, unterliegt ein etwaiger Gewinn grundsätzlich der Einkommensteuer nach § 17 Abs. 1 EStG – sofern die Beteiligung innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens 1 % betragen hat. In diesem Fall handelt es sich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb, der Gewinn ist also steuerpflichtig (vgl. FG Düsseldorf, Urt. v. 30.04.2021 – 1 K 2817/17 E).
Dabei gilt:
-
Anschaffungskosten mindern den Veräußerungsgewinn. Hierzu zählen auch nachträgliche Anschaffungskosten wie verdeckte Einlagen oder Sanierungsleistungen, wenn sie gesellschaftsrechtlich veranlasst sind (vgl. Schiffers, Verdeckte Einlagen – Systematik, 2019).
-
Unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. nach Einbringung gem. § 22 UmwStG) kann ein steuerneutraler oder steuerbegünstigter Verkauf erfolgen – etwa bei Ablauf einer Sperrfrist von sieben Jahren (vgl. BStBl I 2025, 92 ff.).
Sondervergütung für frühere Gründerleistungen
Eine gesonderte Vergütung für Leistungen, die der Gesellschafter in der Frühphase des Unternehmens erbracht hat – etwa Entwicklung, Markenaufbau oder operative Geschäftsführung – kann steuerlich unterschiedlich eingeordnet werden:
-
Wenn vertraglich geregelt, gelten solche Zahlungen als Tätigkeitsvergütungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG und sind als Sonderbetriebseinnahmen steuerpflichtig (vgl. Ott, Handbuch Mittelständische Unternehmen, 170. Lfg. 2025, Teil E).
-
Fehlt eine vertragliche Grundlage, wird die Zahlung regelmäßig als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)qualifiziert. Dies führt auf Ebene der GmbH zum Verlust des Betriebsausgabenabzugs und zur Kapitalertragsteuerpflicht beim Empfänger (vgl. Wochinger, Verdeckte Gewinnausschüttungen, 2025, B.III.3).
Maßgeblich ist in jedem Fall die Fremdüblichkeit der Vergütung – ein zu hoher oder unangemessener Betrag kann eine vGA auslösen (vgl. FG Niedersachsen, Urt. v. 21.06.1994 – VI 250/89).
Verdeckte Gewinnausschüttung bei Verkäufen unter Wert
Wird ein GmbH-Anteil unterhalb seines gemeinen Werts verkauft – etwa im Rahmen eines Exit-Konflikts – kann die Finanzverwaltung den Differenzbetrag als verdeckte Gewinnausschüttung werten, sofern ein gesellschaftliches Näheverhältnis besteht (vgl. FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 24.11.2003 – 5 K 1229/00).
Das gilt insbesondere, wenn:
-
der Verkaufspreis nicht durch objektive Markt- oder Bewertungsverfahren gestützt ist
-
der Erwerber ein nahestehender Gesellschafter oder die Gesellschaft selbst ist
-
keine nachvollziehbare wirtschaftliche Begründung für den reduzierten Preis vorliegt
Der gemeine Wert ist dabei der Maßstab (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG), wobei im Streitfall regelmäßig das Ertragswertverfahren oder das DCF-Modell herangezogen wird (vgl. KÖSDI 2009, 16552).
Anerkennung nicht dokumentierter Leistungen
Gründer leisten oft erhebliche Beiträge in Form von Arbeit, Ideen oder Netzwerken – ohne vertragliche Dokumentation. Steuerlich sind solche Leistungen nur dann als nachträgliche Anschaffungskosten oder verdeckte Einlagenanzuerkennen, wenn sie:
-
eindeutig nachweisbar
-
wirtschaftlich zurechenbar
-
gesellschaftsrechtlich veranlasst sind
Dabei genügt es nicht, dass der Gesellschafter „irgendetwas geleistet hat“ – erforderlich ist eine konkrete wirtschaftliche Wertübertragung, etwa in Form von Know-how, Markenrechten oder erbrachten Dienstleistungen im Gründungsstadium (vgl. FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 26.07.1994 – V 84/93).
Fehlt eine saubere Dokumentation, ist eine rückwirkende steuerliche Anerkennung in der Regel ausgeschlossen.
Der steuerliche Erfolg oder Misserfolg eines Exit-Prozesses hängt maßgeblich von der rechtlichen Qualifikation der Zahlungsvorgänge und der sauberen Trennung von Kaufpreis, Vergütung und Einlage ab. Anteilsverkäufe müssen stets dem gemeinen Wert entsprechen, Sondervergütungen klar geregelt und Leistungen dokumentiert sein. Andernfalls drohen verdeckte Gewinnausschüttungen, nachteilige Einordnungen und im schlimmsten Fall steuerliche Mehrbelastungen auf beiden Seiten.
Bewertung ohne vertragliche Bewertungsregel
Fehlt im Gesellschaftsvertrag eine Regelung zur Bewertung von Anteilen, greifen die allgemeinen Grundsätze der Unternehmensbewertung. In der Rechtsprechung und Praxis anerkannt ist vor allem das Ertragswertverfahren: Es kapitalisiert den nachhaltig erzielbaren Reingewinn der Gesellschaft mit einem angemessenen Kapitalisierungsfaktor (vgl. Kuhfus, EFG 2008, 722).
Ergänzend kann auch der Substanzwert berücksichtigt werden, etwa wenn keine ausreichenden Ertragsdaten vorhanden sind oder Vermögenswerte (z. B. Immobilien, IP-Rechte) eine erhebliche Rolle spielen.
Als steuerlicher Prüfungsmaßstab gilt dabei stets das Fremdvergleichsprinzip, also die Frage: Hätte ein unabhängiger Dritter unter gleichen Bedingungen denselben Preis akzeptiert? (vgl. Schmitt/Apitz, Formularbuch KSt, Stand 11/2024).
Aufbauleistung des Gesellschafters als wertrelevanter Faktor
Besonders streitträchtig ist die Frage, ob persönliche Aufbauleistungen – etwa Entwicklung des Geschäftsmodells, Markenbildung, Kundenakquise – den Wert eines Gesellschaftsanteils erhöhen können.
Grundsätzlich gilt: Wertsteigernde Leistungen eines Gesellschafters können sich in einem höheren Unternehmenswert niederschlagen – und damit mittelbar den Wert seines Anteils steigern. Voraussetzung ist jedoch, dass die Leistung:
-
objektiv bewertbar,
-
wirtschaftlich dem Unternehmen zurechenbar und
-
nicht bereits durch eine andere Vergütung (z. B. Geschäftsführergehalt) abgegolten wurde (vgl. FG Düsseldorf, Urt. v. 30.01.2001 – 6 K 8671/97).
Problematisch ist allerdings die steuerliche Anerkennung solcher Leistungen, sofern sie nicht dokumentiert oder vertraglich vereinbart sind. In diesen Fällen droht die Qualifikation als verdeckte Einlage oder sogar als verdeckte Gewinnausschüttung, wenn etwa eine überhöhte Kaufpreisforderung auf subjektiver Wertzuschreibung basiert (vgl. Wigand, EFG 2017, 734).
Durchsetzung einer fairen Bewertung bei Uneinigkeit
Bei Uneinigkeit über den Anteilswert stehen Gesellschaftern mehrere Wege offen:
-
Gutachterliche Bewertung: Ein neutraler Sachverständiger erstellt ein Wertgutachten auf Basis anerkannter Methoden. Dies ist auch zur Vorbereitung gerichtlicher Verfahren üblich.
-
Selbständiges Beweisverfahren (§ 485 ZPO): Dieses kann zur Sicherung eines Gutachtens genutzt werden, bevor eine Klage anhängig gemacht wird.
-
Gerichtliche Bewertung: Im Streitfall entscheidet das Gericht auf Grundlage eingeholter Gutachten und wirtschaftlicher Kennzahlen (vgl. FG Baden-Württemberg, Urt. v. 07.12.1995 – 3 K 301/90).
Darüber hinaus kann ein Mediationsverfahren helfen, eine konsensuale Lösung zu finden, insbesondere wenn keine klare Bewertungslogik vorgegeben ist.
Bedeutung des Fremdvergleichsprinzips
Das Fremdvergleichsprinzip spielt bei der Preisermittlung eine doppelte Rolle:
-
Zivilrechtlich dient es als Maßstab für faire Vertragsgestaltung zwischen Gesellschaftern.
-
Steuerlich ist es Prüfmaßstab für die Vermeidung unangemessener Gestaltungen, insbesondere im Hinblick auf verdeckte Gewinnausschüttungen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG) (vgl. Masuch/Meyer, ABC des GmbH-Geschäftsführers 2024, C.II.1.c.aa).
Insbesondere bei Verkäufen unter Gesellschaftern oder bei gesellschaftsinternen Anteilsübertragungen wird geprüft, ob der vereinbarte Preis einem Drittkaufpreis standhalten würde. Ist dies nicht der Fall, drohen steuerliche Korrekturen – z. B. Schenkungsteuer, vGA oder Anpassungen bei der Anschaffungskostenfeststellung.
Die Bewertung von GmbH-Anteilen ohne vertragliche Regelung orientiert sich an betriebswirtschaftlichen Standards – insbesondere am Ertragswertverfahren und am Fremdvergleichsprinzip. Aufbauleistungen eines Gesellschafters können den Wert beeinflussen, müssen aber wirtschaftlich greifbar, nachweisbar und steuerlich sauber strukturiert sein. Bei Streit über den Preis ist eine Kombination aus Gutachten, Mediation und gerichtlicher Überprüfung der rechtssicherste Weg, um eine faire Bewertung durchzusetzen – sowohl zivil- als auch steuerrechtlich.
- Projekt 370 – Steuerrechtliche Analyse bei Anteilsverkäufen
- Projekt 370 – Selbstanzeige bei verdeckten Strukturen
- § 370 AO – Strafverfahren und steuerliche Risiken
- Start-up: Wahl der richtigen Unternehmensform
- Creator-Einnahmen richtig versteuern
- Anwalt.de: Steuerhinterziehung durch Influencer – frühzeitig gewarnt
- Anwalt.de: Tagesschau bestätigt Projekt 370 – 300 Mio Steuerhinterziehung
Wenn Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder eine rechtlich fundierte Einschätzung wünschen, sprechen Sie uns gerne vertraulich an.

