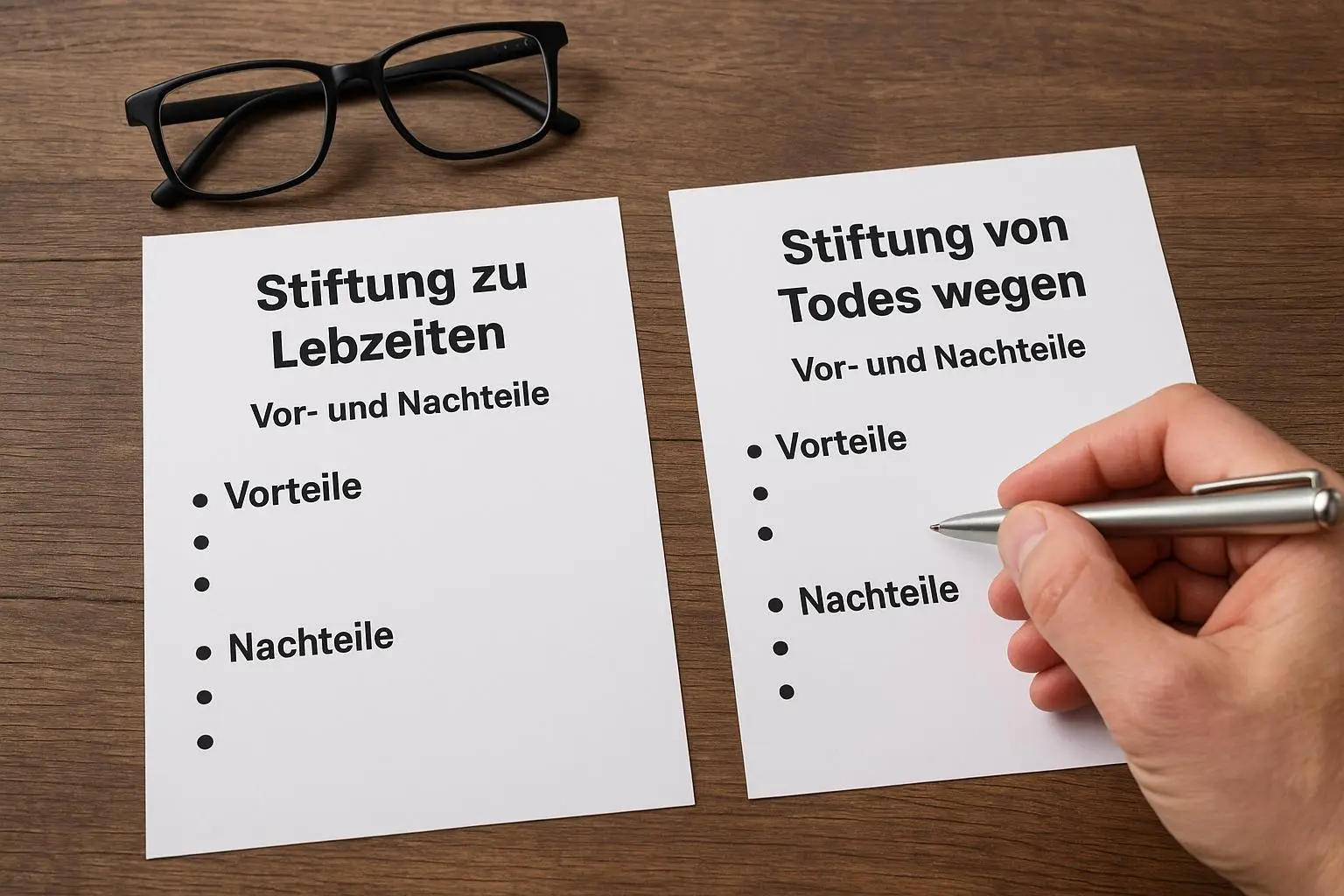
Stiftung zu Lebzeiten vs. Stiftung von Todes: Bei der Planung einer Stiftung stellt sich häufig eine zentrale Frage: Soll die Stiftung bereits zu Lebzeiten gegründet werden oder erst durch testamentarische Verfügung nach dem Tod entstehen? Beide Wege sind rechtlich möglich – und beide haben ganz unterschiedliche rechtliche, steuerliche und strategische Konsequenzen. Dieser Beitrag beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Varianten, zeigt typische Anwendungsfälle und gibt Entscheidungshilfen auf Basis der aktuellen Rechtslage und Stiftungspraxis.
1. Stiftung zu Lebzeiten („inter vivos“) – aktive Gestaltung und Steuerersparnis
Die Gründung zu Lebzeiten bietet dem Stifter die Möglichkeit, persönlich Einfluss auf die Stiftung zu nehmen und sie aktiv mitzugestalten. Der Stifter kann Funktionen im Vorstand übernehmen, Gremien besetzen und erleben, wie seine Stiftung Wirkung entfaltet.
Vorteile:
-
Gestaltungsfreiheit: Der Stifter kann die Stiftung nach seinen Vorstellungen entwickeln, Personal wählen und Strukturen einrichten.
-
Steuerliche Vorteile: Zustiftungen sind bis zu 1 Million Euro (bei Ehegatten gemeinsam) nach § 10b Abs. 1a EStG über zehn Jahre verteilt absetzbar – zusätzlich zum normalen Spendenabzug.
-
Vermögensschutz: Vermögen, das in die Stiftung eingebracht wird, ist dauerhaft dem Zugriff Dritter entzogen (z. B. bei Erbstreitigkeiten).
-
Reputation & Wirkung: Der Stifter kann öffentlich als Förderer wirken und erlebt selbst, wie seine Ziele umgesetzt werden.
Nachteile:
-
Verlust der Verfügungsmacht: Das gestiftete Vermögen geht dauerhaft in das Eigentum der Stiftung über – ein „Rückholen“ ist nicht möglich.
-
Verantwortung & Aufwand: Als aktiver Stifter übernimmt man Pflichten (z. B. Berichtspflichten, Governance), was Zeit und Engagement verlangt.
2. Stiftung von Todes wegen – Sicherheit & Nachlassgestaltung
Bei der Stiftung „von Todes wegen“ wird im Testament oder Erbvertrag verfügt, dass mit dem Tod des Erblassers eine Stiftung gegründet werden soll. Die Rechtsfähigkeit entsteht rückwirkend zum Todeszeitpunkt (§ 84 BGB), die Anerkennung durch die Stiftungsbehörde kann aber erst danach erfolgen.
Vorteile:
-
Verfügbarkeit über Vermögen bis zum Lebensende: Der Stifter bleibt flexibel und kann das Vermögen weiterhin für sich nutzen.
-
Nachlassgestaltung & Konfliktvermeidung: Eine testamentarische Stiftung kann helfen, Erbstreitigkeiten zu vermeiden und die Erbmasse gezielt gemeinnützig oder familiennah zu verwenden.
-
Erbschaftsteuerfreiheit: Gemeinnützige Stiftungen sind gem. § 13 Abs. 1 Nr. 16b ErbStG von der Erbschaftsteuer befreit – das kann erhebliche steuerliche Vorteile bringen.
Nachteile:
-
Keine nachträgliche Einflussnahme: Die Stiftung kann nach dem Tod nicht mehr durch den Stifter gesteuert werden – die Satzung muss daher vollständig und rechtssicher sein.
-
Anerkennungsrisiken: Fehler im Testament (z. B. unvollständige Satzung) können dazu führen, dass die Stiftungsgründung verzögert oder nicht anerkannt wird. In solchen Fällen ergänzt die Behörde nach § 83 BGB „rettend“ – aber nicht immer wunschgemäß.
-
Rechtliche Unsicherheiten: Die Anerkennung durch die Stiftungsbehörde ist zwar möglich, aber nicht garantiert. Fehlt z. B. die klare Zweckbindung oder die Vermögensbindung, kann die Gemeinnützigkeit versagt werden.
3. Vergleich: Stiftung zu Lebzeiten vs. nach dem Tod
| Kriterium | Stiftung zu Lebzeiten | Stiftung von Todes wegen |
|---|---|---|
| Einfluss des Stifters | Voll – kann aktiv gestalten und steuern | Keine – alles muss vorab geregelt sein |
| Steuerliche Vorteile | § 10b EStG: Sonderausgabenabzug möglich | § 13 ErbStG: Erbschaftsteuerfreiheit |
| Verfügbarkeit über Vermögen | Nach Stiftungseinbringung nicht mehr möglich | Bis zum Tod voll verfügbar |
| Gestaltungsrisiko | Gering – laufende Kontrolle möglich | Hoch – Fehler in Testament können fatal sein |
| Öffentliche Wirkung | Der Stifter tritt als Persönlichkeit auf | Wirkung entfaltet sich erst post mortem |
4. Hybride Lösungen und Praxisempfehlungen
In der Praxis werden oft Mischmodelle gewählt. Möglich ist z. B.:
-
Kleine Stiftung zu Lebzeiten gründen, um Erfahrung zu sammeln und erste Projekte umzusetzen.
-
Erweiterung des Stiftungsvermögens im Testament, um nach dem Tod größere Kapitalmengen einzubringen.
-
Kombinierte Struktur aus gemeinnütziger Hauptstiftung und privatnütziger Unterstiftung (z. B. Familienstiftung mit gemeinnützigem Zweig).
Solche Konstruktionen sind steuerlich und rechtlich komplex, bieten aber maximale Flexibilität – und können generationenübergreifende Vermögenssicherung mit gemeinnütziger Wirkung verbinden.
FAQs zur Stiftung zu Lebzeiten und von Todes wegen
1. Was ist der Hauptvorteil einer Stiftung zu Lebzeiten?
Der Stifter kann aktiv mitgestalten, als Vorstand wirken, Netzwerke aufbauen und die Wirkung seiner Stiftung unmittelbar erleben. Außerdem sind steuerlich attraktive Sonderausgabenabzüge möglich.
2. Kann ich zu Lebzeiten eine Stiftung gründen und später weitere Mittel im Testament einbringen?
Ja – das ist ein typisches Hybridmodell. Die Stiftung besteht bereits, wird aber testamentarisch weiter ausgestattet. Wichtig ist die präzise Gestaltung in Testament und Satzung.
3. Was passiert, wenn ich im Testament die Stiftung zu ungenau formuliere?
Dann besteht das Risiko, dass die Stiftung nicht anerkannt wird oder die Behörde sie mit Ergänzungen nach § 83 BGB „zurechtbiegt“. Das kann dem Stifterwillen widersprechen – anwaltliche Hilfe ist hier essenziell.
4. Kann ich über die Stiftung meine Familie unterstützen?
Nicht bei gemeinnützigen Stiftungen. Dafür eignet sich die privatnützige Familienstiftung. Eine Kombination aus beiden ist möglich – aber juristisch anspruchsvoll.
5. Wird die Stiftung von Todes wegen automatisch mit dem Erbfall wirksam?
Juristisch ja (§ 84 BGB), aber die Anerkennung durch die Stiftungsbehörde muss nachträglich erfolgen. Bis dahin gilt die Stiftung als in Gründung.
Ob Sie zu Lebzeiten stiften oder erst in Ihrem Testament eine Stiftung errichten möchten – beide Wege bieten Chancen, erfordern aber unterschiedliche Strategien. Wir helfen Ihnen, die richtige Struktur zu finden, rechtssicher zu formulieren und steuerlich zu optimieren. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Stiftung auf ein solides Fundament stellen.
-Stiftungsatzung gestalten
-Gemeinnützige vs. privatnützige (Familien-)Stiftung
-Arten von Stiftungen
-Steuerliche Vorteile gemeinnütziger Stiftungen
–Anerkennung der Gemeinnützigkeit einer Stiftung
-Stiftungssatzung und Steuer
-Vermögensbindung in der Stiftungssatzung
-Stiftungsorgane und Aufsicht
-Rechtsfähige vs. treuhänderische Stiftung
-Stiftungen und Unternehmensnachfolge

